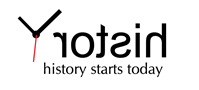Zwinglis Beitrag zur Chronologierevision
Zwinglis Beitrag zur Chronologierevision
Peter Winzeler
Bern · 2005
Dieser Artikel wurde zuerst veröffentlicht in: Zeitensprünge 2/2005 (Gräfelfing/ München)
In einer schlimmen Übergangszeit gegen Ende des Römischen Reiches – andere sagen im 10. Jh., als Basel von wilden heidnischen Ungarn gebrandschatzt wurde – hatte sich in Kellern und Brunnenschächten der in Trümmer gesunkenen Rheinstadt ein scheusslicher, giftiger Basilisk eingenistet (Kröte mit Hahnenkamm, Adlersschnabel, Fledermausflügel, Eidechsenschwanz). Schon die Blicke des Scheusals vermögen auf grosse Entfernung zu töten, sein giftiger Atem lässt Wälder im Augenblick dahin welken, überall hinterliess er für Mensch und Tier mörderische Seuchen. Erst ein unerschrockener Mann mit einem spiegelnden Schild brachte den Satanswurm zu Tode, als er zum erstenmal seine grauenhafte Hässlichkeit erblickte
(nach: Sergius Golowin, Hausbuch der Schweizer Sagen, Wabern 1981).
Auf der Zürcher Jahresstagung wurde die Phantomzeitdebatte in mehrerer Hinsicht fortgeführt:
1. Haben die Phantomjahre im strengen Sinn gar nie existiert, so dass also in einem korrekten Sonnenkalender alle Kalenderjahre kontinuierlich durchgezählt werden könnten (ab Geburt Christi bis A.D. 1000)?
2. Oder markiert die Phantomzeit eine „unscharfe“ Zäsur, die auf einen gestörten Zeitfluss schliessen lässt oder auf unvereinbare Kalenderkalküls, sofern etwa im byzantinischen Osterzyklus nach lunisolaren Inkarnationsjahren gerechnet wurde (Jahr 525 = ADi 532), während in Westen eine millenarische A.D.-Rechnung des Heiligen Römischen Reiches sich durchsetzte (Jahr 614 = A.D. 911)? Welche Auswirkungen würde dieser Sachverhalt 2. für die Christianisierung der Schweiz haben, die nach herrschender Lehre in zwei Wellen erfolgte (a. spätrömische Helvetier und Burgunder; b. irisch missionierte Alamannen)? Reichen die 297 Phantomjahre aus, um die spätantike oder heidnische Symbolwelt des romanischen Kirchenbaus zu erklären ? „Oder sollte man gar 532 Jahre streichen und den Abgang der Römer mit dem Aufgehen der Romanik verbinden ?“, wie G. Anwander auf Grund seiner Auvergnatischen Impressionen fragte [ZS 3/2004,624], die sehr in die Nähe des rätselhaften Kreuzganges des Grossmünsters (11./12.Jh.) kommen.
3. Bestanden karolingisch gestiftete Basiliken in Zwinglis Tigurum (Zürich) schon seit der spätrömischen Pfalz ? Oder sollten sie, nach herrschender Lehre, ottonisch eingeordnet werden ? Je nach Standpunkt klafft vor oder nach der Phantomzeit eine Christianisierungslücke, bis der römische Katholizismus sich in der Schweiz etabliert (s. unten).
4. Welches Gewicht kommt der jüngeren Zeitfälschung zu, die nach Uwe Topper u.a. mit Egon Friedells „letzten grossen Ruck“ (1350) einsetzte, insbesondere in den Konzilien von Konstanz und Basel. Um 1450 – so Topper [33f] – beginne eine „echte Wiedergeburt“ der Antike in einer ersten Phase von einer „gewissen Ehrlichkeit“, die ohne „festen Zeitplan“ operiert, aber die „ältesten“ Qumranrollen ab 1000 rekonstruiert [33f; 167.184f]. Selbst Erasmus und Luther hätten noch „unübersehbaren Anteil an der Bibelschöpfung“ gehabt [18]. Erst 1540 (d.h. nach Zwinglis Tod) beginne eine zweite Phase direkter „Fälschung und Verschwörung“, welche die „Ottonen, Karolinger, Völkerwanderung“ erfunden habe. Kaum zufällig bleibt der Zürcher Reformator unerwähnt, der sich als kritischer Renaissancetheologe verstand. Aber was wusste Zwingli von Antike und Frühchristentum, was könnte seine „Anamnese“ zur Wahrheitsfindung beitragen? Ohne Anspruch eines Gesamtporträts [vgl. Winzeler 1986;1998], folgt hier eine stark gekürzte Fassung meines Manuskriptes (Erstdruck Zeitensprünge 17, Heft 2/2005, 482; ergänzt durch einen Appendix).
I. Zur Quellenlage
Geburt und Kindheit Ulrich Zouinglins (oder ähnlich) sind nur vage zu dokumentieren. In Wien wird der Student im Schwabenkrieg relegiert (1499) und – nach einem Abstecher nach Paris? – in Basel zum Magister promoviert (1506). Seit Teilnahme an den oberitalienischen Feldzügen 1512-1515 bis zu Zwinglis Tod 1531 kennen wir fast Jahr für Jahr die Bücher, die er liest oder schreibt, d.h. Autografen, Druckfahnen, Froschauers Urdrucke (ab 1522), ein Berg von Akten, Korrespondenzen, posthum edierte Predigtnachschriften und seine beachtliche Privatbibliothek, die er für 200 Pfund dem Stift vermachte [s. Köhler, ZB]. Sein Freund Leo Jud hat u.a. Zwinglis „Anamnema“, seine krönende Vorsehungsschrift verdeutscht (1530/2) [s. H 2,1941,79].
Der Schwiegersohn Gwalther legte 1539-45 eine lat. Werkausgabe vor. Zwinglis kühne Synthese von „Gott oder Natur“ wurde von Luther und Calvin abgelehnt und erst von Spinoza und Schleiermacher rehabilitiert, hatte er doch Mose und Platon (op. Venedig 1513), Paulus und Seneca, auch Pythagoras, Plinius (1518), Plutarch (1502), Picus (Strassburg 1504) und Athanasius (Paris 1520) rezipiert: in einer ostkirchlichen Orthodoxie (bzw. nestorianischen Geistchristologie), die ihn vom Augustinermönch Luther schroff unterschied – denn dieser grase „wie eine Sau im Blumenbeet“ der Trinität [Locher, Theol., 104]. Gleichwohl zeigt sich auch ein scholastischer Zug, denn wo Luther an die „via moderna“ Occams anschliesst, die Glaube und Denken in zwei Reiche unterteilt, greift Zwinglis Fidei Ratio (die dem Glauben gemässe Vernunft) auf die „via antiqua“ von Thomas und Duns Scotus zurück. Von Anselm von Canterbury (EA Nürnberg 1491) ist allerdings nur ein „lügenhafter“ Dialog mit Maria belegt [Z I 421: ZB *2 Nr. 5]. Gleichwohl beharrt Zwingli anselmianisch auf der „sündlosen“ Mariengeburt, da Christus wie ein unschuldiges Opferlamm „der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan“ habe [ZwS II,42f; vgl. Locher 134ff; Campi 84f.138].
Der Zwingliverein besorgte im 20. Jh. eine textkritische Edition [Z], auch Zwinglis handschriftliche Randglossen wurden eruiert, deren Schriftbild in der reformatorischen Wende (1516-19) eine deutliche Veränderung erfährt. Von den 400 benutzten Werken der Kirchen-väter oder Josefus (1499), Varro, Sueton (1518) oder Sallust (1513) sind die meisten zu seinen Lebzeiten erschienen (so auch: Aesop 1518; Appian 1526, Aristoteles 1495; Augustin 1506ff; Basilius 1520 etc.). Der Basler Verleger Froben widmete ihm die „Germania“ des Tacitus (1519), als der Leutpriester noch päpstliche Gelder bezog (um all die Bücher zu kaufen!), aber erfolgreich gegen das Soldbündnis mit Frankreich auftrat (1521). Zürich stand im Zentrum der päpstlichen Diplomatie, bis Zwinglis Mentor Kardinal Schiner bei der Papstwahl von Hadrian (1522/23) ausgestochen wurde. „Helvetii autem inter Germanos non censeantur“ (wir sind keine Deutschen) [Z I,270], so lobt Zwingli seine Tiguriner (Zürcher), die dem Papsttum die Stirn boten – wie einst Divico dem Cäsar! Aber das sind Anleihen aus De bello Gallico (Venedig 1513). Denn schon Julius Caesar riet den Helvetiern, „ihr Land wieder zu bebauen“ – warum sollte es nach „sechzehnhalbhundert Jahren“ nicht mehr fruchtbar sein [Z I,94]? Meine weiteren Stichproben orientieren sich sich am Register der soliden neuen Zwingli-Schriften-Auswahl [ZwS I-IV; * =ed. Anm.].
Die Christianisierung der Schweiz: Eine erste Fehlanzeige betrifft den Hunnen Attila und den gallorömischen Statthalter Avitus (443), der die Burgunder nötigte, sich in Savoyen niederzulassen [R.Pfister I, 28], von wo sie mit den Freiheitsbünden der „Alamannen“ verschmolz [Im Hof 112f]. In St. Maurice sind noch Mauerreste einer Gedenkstätte der Thebäischen Legion (4./5.Jh.) zu sehen, wo die Burgunder sich krönen liessen – mit dem Anbau eines romanischen Turms des 10. Jhs. [SS 42.50], konform mit der ältesten Clunyiazensische Abtei von Romainmôtier. Die ersten Chorherrenstifte in St.Maurice und Zürich werden auf zwei karolingische Ludwige, den Frommen und den Deutschen zurück geführt [Pfister I,149f], als die Diözese von Konstanz an die Ostfranken (Deutschen) fiel [63.198]. Zwingli nennt aber nur Theodosius als „frommen“ Regenten, der wohl die spätrömische Diözesenverwaltung einführte, denn Grosskarl sei ein religiöser „Zeremonienmeister“ (kein Rex) gewesen, der die u.a. vita canonica vorschrieb [III.403. 464/475*; Locher, NS 100*]. Den „frommen Ludwig“ setzt Zwingli mit Ludwig, dem Heiligen gleich (13.Jh.). Mit dem „andern Ludwig“ (dem Bayern) hätten die Tiguriner den Bann ertragen, bevor sie sich den Eidgenossen anschlossen (1351) [III 403, 475*]. Dieser erste Befund weist auf eine grössere Gedächtnislücke hin.
Das frühe Taufchristentum: Archäologisch spricht manches dafür, dass die spätrömische Pfalz „schon im 7.Jh. eine christliche Kirche“ hatte [Z V 601*], aber St. Peter gilt als die „einzige“ Kirche, die 857 „zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt“ sei [SS 257]. Zwingli berichtet, dass unter dem 1526 enträumten Altar ein vormaliges Bapisterium freigelegt wurde und dass von allen tigurinischen Tempeln und Basiliken keine Gründungsurkunde „älter als 300 Jahre“ sei [ZwS IV 79]. Der Hochaltar des Grossmünsters wurde 1278 geweiht, darunter befand sich das unversehrte „Pflaster“ des lombardischen Neubaus (1100 – 1230). Also wurden die Altäre des Hochsakramentes erst nach Abschluss des romanischen Kirchenbaues eingeführt. Dies würden auch die ältesten Kirchenagenden in Glarus (Mollis) belegen, wo man vor 250 Jahren noch keine Sakramente feierte [II.158f]. Nach einer Kirchentrennung (um 1300) wurde den Kleinkindern auch die Taufkommunion „in beiderlei Gestalt“ gereicht – dieser Brauch der Waldenser und Hussiten kam aus dem Osten („seit dem 5.Jh.“) und hat in der Diözese Konstanz auch das 4. Laterankonzil 1215 überlebt [Z V,601*], indem man zu Ostern (albae) den Kleinkindern „nicht-konsekrierte Hostien“ reichte. Augenscheinlich rekurriert Zwingli auf ein essenisches Taufchristentum, das in Südgallien erst im 11./12. Jh. belegt werden kann, wo evangelische Wanderapostel, vermeintliche „Weber“ (textores) und „Albigenser“ (Osterleute) aus dem Osten eindrangen [s.Grundmann 13-38.477ff]. Deren asketische Tendenzen wurden von den Clunyiazensern und Hildebrand (Gregor VII.) „zunächst aufgefangen“ [483], aber seit 1215 blutig verfolgt.
Die alte Eidgenossenschaft und Burgund: Seit 1100 lebte in Bern die Idee einer „Burgundischen Eidgenossenschaft“ wieder auf [Felber 30], als die Waldstätten sich von den Klosterherrschaften Zürichs und Einsiedelns lösten (1315) und die Zürcher und Glarner zu Schutz-bündnissen gegen Habsburg nötigten (1351/2). Der Beitritt Berns (1353) war militärisch motiviert. Zwingli setzt die glorreichen Siege bei „Morgarten und Sempach“ (bzw. Näfels 1388) gar in Parallele zu den alten Bünden Israels [I,86f]. Doch der populäre Jan Hus wurde in Konstanz (1414) verbrannt. Nach einem Erdbeben in Basel (1456) wurde in Bern das spätgotische Münster und in Zürich wenigstens die „Monumentalstatue“ Grosskarls errichtet (1470). Das heisst, der Karlsmythus gewinnt erst im letzten Burgunderkrieg seine heutigen Konturen. Habsburg verlor seine aargauischen Stammlande (1474) und Karl d. Kühne von Burgund verlor in Grandson sein Gut, in Murten den Mut und in Nancy sein Blut (1475/6). Kein Ritterheer schien den vermieteten Hallbardieren gewachsen, bis französische Geschütze in Marignano den Rückzug erzwangen (1515). Vom Zürcher Kommandanten und Bügermeister Röist wurde Zwingli ans Grossmünster geholt. Die Zünfte konnten die Macht der Konstaffel brechen (der Constables oder alten Wachtmeister der Pfalz). Auf dennoch viel zu starken Rückhalt der Rentenbezüger in Zürich und Bern führte Zwingli aber seinen Tod in den Kappeler Kriegen (1531) zurück, nachdem im Laurentius (10. Augsten) ein furchtbarer Komet dies angekündigt hatte [s. Bullinger].
Das Kalenderproblem: Im „Heumonat“ (Juli 1522) brach Zwingli mit Rom, karolingisch (ahd.) im Hewimanoth. Der Julianische Kalender hatte sich im Basler Konzil (1431-1449) noch kaum durchgesetzt. Zwingli weiss von apokalyptischen Kalenderwirren des Sacerdotiums und Imperiums [Borst 88-99; Meyer 247-56]. Zwar wurde der Osterzyklus sanktioniert, den Beda von 532 A.D.i auf das virtuelle Jahr 1063 hochgerechnet hatte [Borst 44f; 108f], aber die Vernüpfung der Geburt Christi mit dem Nulljahr blieb prekär. Als skandalös tadelt Zwingli die Legalisierung des Zinskaufes, der den Zehnten, das kirchliche Armengut, in ein unbefristetes Raubgut der Reichen verwandelte: eine „ewige Gülte“ (Rentenkapitalanlage), ungeachtet, ob der Ackerbau Ertrag bringe oder nicht [ZwS I,353ff..409]. Auch wegen dieser Zerrüttung oder „Pest“, die Zwingli den Prästen nennt – alamannisch ein Mauerriss oder (Treue-) Bruch – erstrahle „die reine Lehre Christi heute klarer als in den 1300 Jahren zuvor“ [II,489]! Da diese 1300 Jahre vor Konstantin zurück reichen und mit den 1550 Jahren seit Cäsar sich nicht zusammen reimen, schlossen die Editoren auf „1400 Jahre“ seit dem Apostelkonzil [Z II,553*]. Denn nach diesem Urbild haben die Zürcher Räte ihr eigenes „Konzilium“ abgehalten (1523). Zwingli wird als Stadtpfarrer approbiert (mit einer Chorherrenpfründe von 60 Pfund), die Zehnten werden in eine gemeinnützige Ertragssteuer umgewandelt, die Gerichtsbefugnisse der Chorherren an den Rat übertragen, das Messopfer abgeschafft (1525). „Binnen 10 Jahren“ wollte Zwingli die Zinsverträge ablösbar machen, beim Zinsfuss von 5 % des Kapitals oder nach mittleren Ertragswerten – was der Rat 1529 nur teilerfüllte. Das hätte die Böden massiv entlastet und den Ackerbau wieder attraktiver gemacht [s. ZwS I, 322.407f].
Die apostolische Sukzession: Im Apostelkonzil hatte Jakobus das Sagen – nicht Petrus, nicht schon der Bischof von Rom. Auch nach Platinas erster Geschichte der römischen Päpste (Venedig 1479) verspottet Zwingli den römischen „Messkanon“. Dieser gehe ja auf „zwei Gregore“ (I./III. ?), „zwei Alexander“ (I./ ?), „Sergius und Leo“ zurück, die alles besser als Ambrosius wissen wollten und jeder zufügten oder wegliessen, was sie wollten [Z II, 564f. 565*]. Die Urkirche der ersten 500 Jahre kannte kein Messopfer. Das Wort Messe stamme von der hebräischen „missa“ (= etwas aus der Hand lassen), die nur die gottesdienstliche „Entlassung“ (lat. mitta, missio) mit einem Segensgebet bezeichnet habe. Zwingli anerkennt Benedikt und Bonifaz, aber keine Päpste diesen Namens. Als Päpste „und Päpstin“ [ZwS II, 335] veräppelt er „Alexander (VI.), Julius (II.), Leo (X.) und Hadrian (VI.)“ [III, 217. 465f*]. Mit der von Laurentius Valla entlarvten Konstantinischen Schenkung verfalle auch das Recht der Päpste, „mit der Zeit das ganze römische Reich zu beherrschen“ [II,286, 512*], woran auch Cäsar und Alexander scheiterten [I,121]. Auf keine Weise verbürgt Zwingli eine lückenlose apostolische Sukzession.
Das Kirchenrecht: Das von Luther vermeintlich verbrannte Corpus Juris Canonici wird erst von Gregor XV. so benannt [II.72, 508*], das grundlegende „Dekretum Gratiani“ (EA 1471) erst 1582 in Rom vereinheitlicht. Nach Zwingli aber waren alten canones seien freie Übereinkünfte der Synoden, noch keine „regula“, keine päpstlichen Dekretalien. Im Zweifelsfall sollten die Kirchenväter der hlg. Schrift und „nicht die Schrift den Vätern weichen“ (Caput VIII can. 4-9; IX can. 3.8.10) [I,293]. Ein begnadeter Mönch (wie Gratian) hätte nur zu Lehrzwecken eine Zusammenschau („Concordia discordantium canonum“) erstellt. Ein Vergleich mit dem Talmud legt sich nahe (250-700). Denn die „dicta“ [Gratiani] (um 1140) geben nur die Meinung des letzten Lehrers wieder, sei es des Rabbenu (wie Raschi) oder karolingisch/arabisch: des Hrabanus Maurus, des praeceptor Germaniae. Dessen Schüler Lupus, meint Zwingli, sei eine gefälschte Messlitanein unterschoben worden [II.250. 512*]. Zwingli stützt sich auf Gregor [d. Gr.], als die Zehnten noch der Chilchhöri gehörten, den [Zuge-] Hörigen der Parochie (Kerke/ Kyriake). Ausser Hildebrand (Gregor VII.) [II,517*] führt er das „Liber Extra“ von Gregor IX. an [I.201.293. 352-54: II.506*]. Das sind Extravaganzen wie die ausgesonderten Stoffe (Baraita) oder Zusätze (Tosefta) der Mischna, die scheinbar 500 Jahre vor Gratian datieren, so dass dessen „unmittelbare Quellen“ im Dunkeln bleiben [TRE, Gratian 126].
Fazit: Bei all diesen Stichproben reicht die Phantomzeit von 297 Jahren zur Überbrückung kaum aus. Anderenseits bezweifelt Zwingli nicht die historische Existenz von Cäsar, Theodosius und Grosskarl. Er verweigert sich jeder konspirativen Aktion. Sein Schrifttum bildet somit einen Brückenkopf ins unverfälschte Zeitbewusstsein des frühen 16. Jhs., noch bevor das mechanistische Weltbild aus der „frühneuzeitlichen Aufklärung“ hervorging [s. Krolzik 55ff. 68]. Erst 1538 wurde am St.Peters-Turm das erste mechanische Uhrwerk Europas montiert. Einige Indizien sprechen dafür, dass Zwinglis die moderne astronomische Chronologie nicht anerkennt.
II. Der Zeitenspringer und die seligen Juden und Heiden
Zwingli hat die Antike als „Fundgrube“ benutzt und als Spiegel seiner Zeit [s. Locher NS,75-103.97]. Die 1500 Jahre seit Christus werden geteilt in 500 Jahre Urkirche (Jakobus), wo das Evangelium in Geltung stand, und 1000 Jahre des römischen Papsttums, die einer millenarischen Verderbnis entsprechen. Weil das Wort Gottes in der Gegenwart „erschallt“ [ZwS III,39f], lässt es die „ungezählten Jahrhunderte“ dieser Finsternis „überspringen“ [NS 82f]. Auch die Seelen von längst Verstorbenen bleiben präsent, denn „was für uns lange dauert, ist für die Geister der Verstorbenen alles Gegenwart“ [II,472]. Von daher starb Christus für alle Juden und Heiden, „die je waren, sind und sein werden“ [3.Artikel 1523]. Mit Abraham, Mose und David, die den Messias erhofften, würden auch „Herkules, Theseus, Sokrates“ oder die Catonen und Scipionen die Seligkeit erlangen [IV, 340]. Von Giovanni Picus und dem christlichen Neffen Gian Francesco de la Mirandola hat Zwingli offensichtlich auch einen guten Schuss Kabbala übernommen [Zürcher 182ff].
Als weiteres Indiz hat Abrecht Dürer sein Selbstporträt mit der mystischen Jahrzahl „A.D. 1500“ geziert [Topper 32]. Dürer soll auch Zwingli als rotblonden „jungen Mann“ in Basel porträtiert haben: „A.D. 1516“ [Locher NS 147]. Zwingli schrieb damals das griech. NT des Erasmus ab, das er mit Hieronymus, Origines und Augustin glossierte. Dieser „Urtext“ war miserabel, aber Zwingli lernte Hebräisch und übernimmt (1525) die alttestamentliche Professur der Zürcher Prophezey (1525), wo er den Wortgebrauch am griech. und hebr. AT überprüft – denn man solle „zu den Hebräern laufen“, um dunkle Bibelstellen zu erhellen [s. Detmers 158f]. Zwingli verteidigt die Juden, die ein „fleischliches“ Essen des Leibes Christi verabscheuen [Joh 6; ZwS III, 263]. Das lat. „sacramentum“ war nur eine Bürgschaft oder Eidesverpflichtung, der Fahneneid der Legionäre.
Die letzten Worte Jesu erinnern nicht zufällig an die Einsetzung des Passah – „Dies ist das Vorüberschreiten“ d.h. die Verschonung von blutiger Rache [Ex 12,11; ZwS IV, 12]. Jesus gab den Jüngern nicht seinen Leib zu essen, aber verpflichtete sie auf den Neuen Israelbund, der jeden weiteren Blutgenuss untersagt – wie es Jakobus entspricht. So gewinnen auch Zwinglis archäologische Beweise an Gehalt, die er Luther im Abendmahlsstreit entgegen hält [Berner Credopredigt ZwS IV,79; vgl. Amica exegesis…ad Martinum Lutherum 1527: Z V 601ff].
Zusätzlich führt er an:
a) „Auf der ganzen Welt findet man kein Sakramentshäuschen, das älter als 200 Jahre wäre“ (cis Rhenum datieren diese Tabernakel im 14. Jh.). „Die alten Kirchen hatten keine Sakristeien“ (im Osten seit dem 5. Jh. [IV 126f*]).
b) „Weiter Mitteilungen, von denen es viele gäbe, müssen wir der Kürze halber übergehen“. Dazu gehören irische Pönitentiarien, deren drakonische Strafen erst durch die römische Ohrenbeichte, Geldbussen, Spenden und Messen abgelöst wurden, ebenso die privaten Kaplaneienpfründen (Capellania, Vicaria), die seit dem 12. Jh. zur Lesung der Messe verpflichtet waren [Z V,601*], wo Zwinglis Angabe „also ungefähr“ korrekt erscheine.
Im Täuferstreit vertrat Zwingli die Säuglingstaufe, die er auf die urchristliche Ablösung der jüdischen Beschneidung zurück projizierte. Gleichzeitig verwirft er die Erbsündenlehre. Denn das Grundübel sei der Prästen (Gebresten), eine Todkrankheit (morbus) wie die Pest. Kleinkinder begehen keine Sünde, solange sie in der Thora nicht unterwiesen sind. „Wo kein Gesetz, ist keine Übertretung“ [Röm 4,16], noch eine verdiente Strafe (sine lege nulla poena) [IV,105-109]. Kein ungetauftes Juden- der Heidenkind müsse also fürchten, ewig in der Hölle zu schmoren! Es kann die „Sünde der Väter“ den Kindern nicht seit Adam angerechnet werden. Weit besser wäre, Erwachsene zu taufen und Kleinkinder zu unterweisen [II, 146]. Nur der Zwang zur Taufwiederholung sei dem Evangelium zuwider (= Katababtismus), genauso wie eine magische Wiederholung des Messopfers.
Daher verlegt Zwingli das Glaubensbekenntnis von der Taufe in die Eucharistie. Sie ist der Ort der erinnernden Vergegenwärtigung (anamnesis) des einmaligen Passahleidens Christi. Denn die handelnde Gemeinde solle sich in den irdischen Leib des auferstandenen Christus verwandeln und sich aktiv zum kommenden Herrn und Richter bekennen: „Das tut zu meinem Gedenken!“
III. Zwinglis „Anamnema“ und der letzte grosse Ruck
Denselben Begriff greift Zwingli im „Anamnema“ seiner Marburger Predigt auf, die er für Philipp von Hessen aus dem Gedächtnis (bzw. zur Erinnerung) aufschrieb. Diese Schrift erinnert symptomatisch an den letzten grossen Ruck, den Friedell als die letzte „schwere Erkrankung“ des Abendlandes beschrieb. Daraus erwuchs die Geisslerbewegung als einer massenhaften Bussbewegung, welche die Klöster verliess. Es musste dem antiken Götterzorn kein neues Menschenopfer mehr dargebracht werden, denn die Himmelsplagen gelten als Zuchtrute des liebenden Vaters, der „uns mit langwährendem Unglück“ plagt, „bis wir unsere Schuld im Lande unserer Feinde erkennen“ [ZwS III,40].
Durch Abbüssen von Sünden oder Abtöten der bösen Triebe galt es, Genugtung zu leisten, um am Verdienste Christi teilzuhaben, was aber Zwingli anselmianisch in eine evangelische Schuldenbefreiung konvertiert. Denn im Christus ist die Erlösung vollbracht, alle Schuld schon bezahlt. Schon als Jesus gekreuzigt wurde, tobten die Naturgewalten, es entbrannte Gottes Zorn, die Sonne verbarg sich, die Erde zerbarst, um ihre Toten wieder her zu geben [III 162ff]. Also hat Jesus mit seinem Opfertod „genug getan“, um den Gotteszorn zu stillen (= Satisfaction). Neuer Opferwahn würde die Güte der Gottheit erst recht beleidigen.
Als eine neue Pest (1519) einen Fünftel der Stadtbevölkerung weg raffte, hatten die Sterndeuter auf das Jahr 1524 wohl eine Sintflut und den Weltuntergang angedroht [IV, 248ff]. Der Rhein trat über alle Ufer, aber Gottes Vorsehung hat uns „genug Land zum Bewohnen übrig gelassen“. Jetzt drohe „ein ganzer Haufen von Übeln über uns herein zu brechen – die Unterdrückung der öffentlichen Gerechtigkeit, Prunksucht, Luxus und Schamlosigkeit, das schlimmste aller Übel, eine Überschwemmung, die viel schädlicher ist, als wenn Menschen und Tier ertrinken“ [ebda]!
Das natürliche Übel wird von Zwingli also auf das gesellschaftliche rückbezogen, auch psychoanalytisch hat seine theologische Angstbewältigung die anderen Reformatoren überragt, weil sie „analytisch“, nicht zwangsneurotisch argumentierte und den Hexen- und Täuferjagden weitgehend widerstand [Oskar Pfister].
In die ptolemäische Himmelsmechanik setzt Zwingli kein Vertrauen, denn ohne die göttliche Urkraft, die „alles erhält, alles regiert“ [II,61], würde das All sogleich im Nichts zerfallen. Es wäre vergeblich, auf sekundäre Ursachen – wie die ohnehin zweifelhafte Rattenpest [s.Hagmann] – zu rekurrieren: „die (sogen.) Zweitursachen werden zu Unrecht Ursachen genannt“ [IV,151]. Wenn Gestirne aus den Bahnen fahren und ihre Macht „den Menschen zornig erscheint“, dann nicht aus eigenem Antrieb, sondern „als Werkzeuge der göttlichen Urkraft“ [IV 250f]. Also haben jene Sterndeuter sowohl die Naturgesetze verkannt, durch welche Gott die Weltordnung passiv aufrechterhält, wie die göttliche Vorsicht, die aktiv „auch ausser der Ordnung“ interveniert. „Denn Gott wirkt Wunder ausser der Ordnung“, damit die Sterndeuter (Astrologi) und Titanen, die gegen die Alleinherrschaft der Gottheit kämpfen und auf „unbestimmte natürliche Ursachen“ rekurrieren, gezwungen sind,
„eine Energie anzuerkennen, die grösser ist, als das Sichtbare sie hat. Sie sollen sehen, wie Feuer aus dem Himmel hervorging und plötzlich fünf Städte auslöschte [vgl. Weish 10,6] oder wie die Sonne mitten in der Bahn stehen blieb [vgl. Jos 10,12f]“.
Ein mechanischer Determinismus ist Zwingli fremd. „Wenn ein Astronom sieht, dass die Sterne ernsthaft drohen, sollte er sich zugleich über die Weisheit der Gottheit verwundern, die den Lauf der Himmelskörper seit Erschaffung des Firmamentes so gelenkt hat, dass auch von den Sternen her ein schicksalshaftes Unglück über eine Zeit droht, in der alles verbrecherisch ist“. Das spricht weniger für eine prästabilisierte Harmonie, als eine vorprogrammierte Disharmonie, welche die gottlose Menschheit wachrütteln soll [vgl. „warum die Weisheit nicht gefehlt hat…“: IV, 198-206] .
Daher rückt der Präventionsgedanke ins Zentrum. Die Astronomie wäre allein nie in der Lage, die Bedeutung der Sternzeichen natürlich zu erfassen. „Was also die Astronomen werweissend in den Sternen lesen, liest der Prophet aus der heiligen Schrift, wo Gott klar seinen Willen kund gibt“. Wenn andernseits die Prediger die „masslose“ Astrologie zu Recht tadeln, sollten sie doch deren Nutzen sowenig verachten „wie die Gestirne selbst“. Die Revolutionen, „durch die die Welt nun erschüttert wird, geschehen nicht zufällig“, sondern „aus göttlicher Vorsicht“, so dass „sowohl die Prediger Gottes Rache androhen als auch die Astronomen bevorstehende Übel früherkennen können“. Beide Methoden haben komplementäre Bedeutung, „damit uns der Weg zur Umkehr und zum Heil besser zugänglich werde“.
Auf diese Komplementaritätstheorie stützt Zwingli auch seine Relativitätstheorie: „Es wäre weit gefehlt, anzunehmen, dass sich die Gestirne ohne Bezug zu den unteren Dingen bewegen“. Denn wenn da auch „nur irgend etwas zufällig einträte, ohne die Vorsicht Gottes, könnte mit selbem Recht gesagt werden, dass alles zufällig geschieht; denn wenn die Vorsicht ein einziges Mal aussetzt, hebt dies (Manko) sie gänzlich auf“ [alles frei nach ZwS IV,246-250 und Leo Jud 1532].
Zwingli vertraut in die Güte des Schöpfers, nicht der Himmelsmechanik, die aus dem Ruder laufen müsste. Mit einer Gravitationskonstante ist es nicht getan. Selbst Isaak Newton bedurfte des Eingreifens einer unsichtbaren Hand. Erst Ed. Halley (1705) hat Zwinglis Kometen als „regulären“ berechnet (1305 – 1456 – 1531- 1607 – 1682 – 1758), auf den sich die konstante Zeitrechnung gründet. Demnach erschien1337 ein irregulärer Komet: „Berge versanken in der Erde…Die Luft wurde dick und stickig. Es gab dichten und furchterregenden Nebel. Der Wein gor in den Fässern. Feurige Meteoriten erschienen am Himmel. Hunderte beobachteten eine riesige Feuersäule, die sich auf das Dach des Papstpalastes von Avignon herab senkte“ [s. Velikovsky 101f]. Denn auch der Erdmantel sei eine prekäre Mischung von Erde, Feuer, Wasser und Luft, so dass die Konstellationen „Winde, Erdbeben und Stürme erzeugen“ und „alles, was von oben oder von unten durch die Kraft der Himmelskörper…geschieht“, allein durch die „gegenwärtige Kraft der Gottheit“ gelenkt sei [IV, 250f]. Zwingli ist von Velikovskys Kosmos „without Gravitation“ gar nicht weit entfernt.
Zur Prävention bedarf es schliesslich der tatkräftigen Weisheit Josefs in Ägypten, der hebr. CHOKMA („Herrin der Maat“) [IV,147f]. Denn wenn Gott die himmlischen Chaosmächte in Schranken hält, soll der Mensch auf Erden „um Gottes willen“ das Menschenmögliche tun. Gottes Allmacht ist keine Despotie (wie Luther sie sah), sondern von der Weisheit gelenkt (nach Leo Jud: der „herrlichen Frau“), die dafür sorgt, dass der Zorn mit der Liebe, die Gerechtigkeit mit dem Erbarmen ausgesöhnt werden [IV, 204f.213-15]. So appelliert Zwingli an den jüdischen Gedanken der Einheit Gottes, wie an die (in Christus erwiesene) Güte Gottes, die beide nicht zulassen können, dass die Welt zum Teufel gehe. Gott muss selber tun, wovon Abraham verschont blieb – und seine Vernichtungswut sozusagen am eigenen Sohn endgültig ertöten.
Es bleibt die Frage, inwiefern wir dieses anamnetische Denken noch reproduzieren können. Die Geografen vor Zwingli „untersuchen das Sintflut-Problem nicht“, „nur im reformierten Westeuropa“ wird es in der Geografie wie in der davon emanzipierten Geologie behandelt [Büttner Anm. 30]. Aber in der modernen Rationalität ist der innere Zusammenhang mit dem „verschonenden“ Passahopfer Christi längst erloschen. Es fällt schwer, von einem Tsunami auf menschheitliche Ethik und Gottes Vorsicht zu schliessen. Gleichwohl steht Zwinglis Anamnema am Anfang jeder neuzeitlichen Prävention.
Appendix: Zwingli und die Phantomzeit
a) St. Peter: „Als der Hochaltar…seinerzeit abgerissen wurde und man 1527 an seine Stelle einen Taufstein setzen wollte, stellte sich heraus, dass ebenderselbe Taufstein früher genau da gestanden hatte. Bei der Räumung entdeckte man nämlich einen Wasserablauf… und er war die ganze Zeit unter dem Altar zugemauert geblieben“ [ZwS IV,79]. Est nach Zwinglis Tod kamen das „spätgotische“ Uhrgeschoss 1538 und die grossen Zifferblätter St.Peters hinzu [SS 250]. Das Kirchenschiff von 1705/6 sei der erste spätgotische Neubau „seit der Reformation“. Im Berner Münster begann die Gotik vor der Reformation. Im Grossmünster waren die „ältesten aufgefundenen Reste“ die romanischen Fundamente „einer dreischiffigen spät-ottonischen Anlage“, die 1100-1230 durch einen „spätromanischen“ lombardischen Neubau „ersetzt“ wurde [SS 120]. Die beiden Türme wurden 1487-92 „auf gleiche Höhe gebracht“, die „spätgotischen“ Turmkronen 1781-87 aufgesetzt und das alte Chorherrenstift 1850 durch eine „neo-romanische“ Imitation ersetzt [SS 120].
b) Grossmünster: Zwinglis Zankapfel war der „Hochaltar“, unter welchem das unversehrte Pflaster der spätromanischen Basilika lag und der „1278 vom Bischof Hartmann von Augsburg geweiht“ wurde. „Früher wurde kein Altar, auch kein Hochaltar, mit der Kirche gleichzeitig gebaut“ [IV,79]. Kommentatoren meinen, der „hintere Chor“ sei schon vorher (etwa 1180-1230) erbaut, aber erst hinterher (1280-85) „eingewölbt und geweiht“ worden [Z V, 600*]. Mit dieser kleinen Chronologierevision liesse sich eine grosse Kalenderreformation vemeiden. Aber „merkwürdigerweise“ blieb der tiefe Chorbogen erhalten, der den Chor vom erhöhten Kirchenschiff wie eine „optische Schranke“ trennt. Also sei die Einwölbung des Mittelschiffes die „letzte Phase“ gewesen (1225-30) [SS 120].
c) Weitere Beweise fand Zwingli in den Bussenkatalogen der irischen Mönche, den Pönitentiarien. Nachdem diese zunächst wörtlich befolgt wurden (Qumran !), wurden sie von „verschlagenen Beichtvätern“ in einträgliche Geldbussen, Spenden, Messen und Ablässe umgewandelt [Art. 53; II,447]. Die Ohrenbeichte gab den Beichtvätern unbegrenzte Macht, um die Schlüsselgewalt des Petrus zu missbrauchen. Statt dass Jesus genug „bezahlt“ hätte, wurde Christi Sühnopfer nur auf den Erlass der Todesstrafe bezogen, so dass die Gläubigen „Genugtuung“ leisten müssten, um an dem päpstlich verwalteten Gnadenschatz teil zu haben.
d) Von den poylgamen Merowingern und ihrer (essenischen?) Christianisierung (wie Childerich = Huldrych; Chlodovech = Ludwig; Chlothar = Lothar) weiss Zwingli nichts. Sie ragen wie ein alttestamentliches Heidentum in die karolingische Davidszeit hinein.
e) Aus der spätmittelalterlichen Welt stammt die Substitutionstheorie, weil reiche Büsser Ersatzmänner fanden, die sie für sich leiden lassen konnten oder das keltische Manngeld („Wergeld“) dafür bezahlten. Patrizier liessen Kaplane für sich Messen lesen, damit sie von Fegefeuerstrafen verschont würden [Art. 57]. Gegen allen diesen Unfug vertritt Zwingli die einsame Antithese Anselms von Canterbury (11.Jh.). Mag sein, dass er ihn in jungen Jahren in Wien gelesen hat, aber warum hätte er diesen Gewährsmann nie gegen Thomas und Luther anführen sollen ? Warum sollte erst Karl Barth mit Anselm gegen Luther argumentieren ?
f) In Bezug auf die Zehnten (Dist. 66 caput XVI, q 1; 44 XVI q. 1; 68 XVI q.1) und den „Liber Extra“ will Zwingli darlegen, dass der Zehnt ein Armengut war, das Chilchhöri gehöre, den Zugehörigen des Kirchenkreises (kerke der Kyriake), die dieses Gut „zusammen legen“ [I.201. 353-56]. Das schliesst den Unterhalt der Mönche oder Priester mit ein, sofern sie nicht eigene Mittel haben und sich nicht (wie Simon Magus) am „Diebesgut“ bereichern. So war es unbegreiflich, wie „unbesonnen“ die Konzilien in Konstanz und Basel den laizistischen Rentenkauf (Zins- oder Früchtekauf) zuliessen, der die Zehnten in einen privaten „Fruchtnutzen“ oder Geldzins umwandelte, „ungeachtet, ob er Ertrag hat oder nicht“ [205].
Ein mosaischer Fruchtteil wäre „weniger wider Gott“, als eine solche mörderische Kapitanlage, welche die Böden auslaugt, die Bauern aushungert und in die fremden Dienste treibt [352ff.409; vgl. 89f!]. 1525 wurde die Leibeigenschaft formell aufgehoben und der „kleine Zehnt“ teilweise erlassen (1525), unter Zwinglis Zusage, man wolle die vererbten Gülten „binnen 10 Jahren“ ablösbar machen, den Zinsfuss auf 5 % des Ertragswertes (so Zwinglis Gutachten !) oder der Kapitalanlage reduzieren (so der Rat 1529). Am liebsten hätte Zwingli den „ungerechten“ Zins (der allein 20 % der Erlöse frass) absterben lassen [I,408.453*]. Wenn Gläubiger aussterben und Gläubige keine neuen Zinskredite auf die Güter legen, liesse sich der Rechtsfrieden wahren, die Arbeit würde lohnender und das Reislaufen unterlassen (Aufruhrschrift 1524)!
g) Bei Marius und Sulla lasse sich aus der Geschichte der Römer viel Nützliches lernen, „was das Recht der Konfiszierung bürgerlichen Eigentums dem Denunzianten bringt“ [II,370]. Wenn auch Gemeineigentum von Machthabern widerrechtlich privatisiert wurde, müssten Vertragstreue und Rechtssicherheit dennoch gewahrt bleiben, wie Zwingli den Täufern entgegenhält [I,333-426]. Also gibt es nur eine biologische Lösung des Absterben-lassens der Grundeigner, die von ferne an Lenins „Absterben“ des Staates erinnern könnte.
h) Im Lehrstück „De homine“ macht Zwingli von Pico della Mirandola Gebrauch (De providentia [IV,178ff]), der die Menschenwürde pries, gleichwohl werden Plato, Cicero und Caesar zu Beispielen eitler Beredsamkeit und „Ruhmsucht“ [III,85-87]. Cäsar fiel „mit Anstand“ (Sueton), aber er fiel [III, 205], da die Vorsehung auch einen Brutus gebrauchen kann, um der „Demokratie“ ihren künftigen Platz zu geben [IV 265f]. Noch fleissiger als Giovanni Picus wird sein Neffe Gian Francesco exzerpiert, der sich in seiner Vorsehungsschrift als Christen bekannte [Schindler I,485]. Gleichwohl bleibt ein kabbalistischer Hintergrund präsent, mitsamt den kanonischen Rechten (C.J.C. 6 IX), man solle „zu den Hebräern laufen“, wenn dunkle Bibelstellen das erfordern [s. Detmers 159]. Zwingli bleibt der einzige Reformator, der sich vom Antijudaismus und der Judenmission frei gehalten hat und die Juden als Teil des erwählten Gottesvolkes versteht.
i) Nicht also Luthers mönchische Frage des Heilsegoismus bewegt Zwingli: „Wie kriege ich einen gnädigen Gott ?“. Sondern die Verantwortung für Andere, an der (jüdisch) das ganze Seelenheil hängt: „Was tue ich, der gute Hirte, dass nicht das Blut meiner Schafe von mir gefordert wird ?“ Das aber sind politische Fragen der Vorsehung, der Vorsorge und Ökonomie. Für die angsterfüllte Werkheiligkeit Calvins (Wie kann ich mich der unsicheren göttlichen Erwählung vergewissern ?) und die Folgen des asketisch-rationalen „Geistes des Kapitalismus“ kann Zwingli – wie Max Weber sah – nicht verantwortlich gemacht werden.
Literatur:
Bornkamm, Heinrich(1983), „Kopernikus im Urteil der Reformatoren“, in ders., Das Jahrhundert der Reformation, Frankfurt 1983,230-240.
Bullinger, Heinrich, Reformationsgeschichte III, 46; zit. bei Markus Griesser, Die Kometen im Spiegel der Zeiten, Bern 1985,129.
Büttner, M. (1975), Regiert Gott die Welt? Vorsehung Gottes und die Geografie, Stuttgart
Campi, Emidio (1997), Zwingli und Maria, Zürich
Cohen, Norman (1961), Das Ringen um das tausendjährige Reich
Detmers, Achim (2001), Reformation und Judentum, Stuttgart
Friedell, Egon(1976), Kulturgeschichte der Neuzeit. München 7.Aufl. l. Bd. 1,95-172.195f;
Grundmann, Herbert (1935), Religiöse Bewegungen im Mittelalter, 4. Aufl. 1977
Hagmann, Michael, Der schwarze Tod, SonntagsZeitung (Zürich) 28.9.2003
H = Zwingli Hauptschriften 11 Bde hg.von Fritz Blanke et alii, Zürich 1940ff
Illig, Heribert (1985), Egon Friedell und Immanuel Velikovsky. Gräfelfing
Im Hof, Ulrich et alii (1982) (dt. Red. Beatrix Messmer), Geschichte der Schweiz – und der Schweizer, Basel/Frankfurt a.M., Bd 1,
Köhler, Walther (1954), Huldrych Zwingli, Nachdruck der 2. Aufl. , 1984 Leipzig [=HZ]
(1921) Zwinglis Bibliothek, Neujahrsblatt des Waisenhauses 143, Zürich [=ZB]
Krolzik, Udo (1988), Säkularisierung der Natur. Providentia-Dei-Lehre und Naturverständnis der Frühaufklärung, 55-58, Anm. 133.
Marx, Christoph (1996), „Der (bislang) letzte Grosse Ruck“, in ZS 3/96,339ff.
Meyer, Walter E.(1987), Huldrych Zwinglis Eschatologie, Zürich
Locher, Gottfried W.(1952), Die Theologie H. Zwinglis im Licht seiner Christologie, Zürich, 134-150.136 (ein „deutlicher Anklang“ zu Anselm liege u.a. im Epilog des Anamnema vor: „…nos autem de summo loquimur, supra quod nihil est neque esse cogitari potest“, 47 Anm. 47).
(1969) Huldrych Zwingli in neuer Sicht [=NS], Zürich
Pfister, Oskar (1944), Das Christentum und die Angst, Zürich
Pfister, Rudolf (1964) Kirchengeschichte der Schweiz, Bd 1. Zürich
SS = Speich, Klaus/Schläpfer, H. R., (1982), Kirchen und Klöster in der Schweiz, 3.Aufl. Zürich
Topper, Uwe (2003), ZeitFälschung. Es begann mit der Renaissance. München
Velikovsky, Immanuel, Das kollektive Vergessen 1987 [Mankind in Amnesia].
Winzeler, Peter (1986), Zwingli als Theologe der Befreiung, Basel
(1985), „Wer Ursache zum Aufruhr gibt“ (1524), in: ZwS I, 331-426
(1998), „Losend dem Gotzwort!“ G. W. Lochers Bedeutung für die Zwingliforschung, in: Zwingliana XXV, 1998,43-63
Z = Huldreich Zwinglis Sämtliche Werke, hg. Emil Egli et aliis (= Corpus Reformatorum LXXXVIII-CI), Berlin-Leipzig-Zürich 1905-1959 (usw.)
Zürcher, Christoph (1975), Konrad Pellikans Wirken in Zürich 1526-1556, Zürich
ZwS = Huldrych Zwingli Schriften, im Auftrag des Zwinglivereins hg. von Thomas Brunnschweiler et aliis, Theol. Verlag Zürich 4 Bde 1995